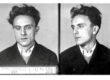Ein Bahnhof der Hoffnung und des Schreckens
Auf dem Wiener Nordbahnhof kamen viele Jüdinnen und Juden aus galizischen Schtetln an, um sich in der Metropole eine neue Existenz aufzubauen. Dass vom selben Bahnhof auch die Deportationszüge nach Auschwitz fuhren, ist heute fast vergessen.
Text: Bernhard Odehnal
Am 6. Jänner 1838 begann für Wien das Eisenbahnzeitalter. Gegen 9 Uhr 30 verließ der erste mit Personen besetzte Zug den Nordbahnhof, fuhr über eine provisorisch errichtete hölzerne Donaubrücke nach Floridsdorf und weiter nach Deutsch Wagram. Der Nordbahnhof war damals noch recht klein, gewann aber sehr schnell an Bedeutung. Denn in den folgenden Jahren wurde die Nordbahn bis Mähren und Schlesien verlängert und brachte Kohle und Stahl in die schnell wachsende Hauptstadt.
1865 wurde deshalb ein Bahnhof errichtet, welcher der Bedeutung der Bahn entsprach. Ein mächtiges Gebäude im neugotischen Stil, mit Säulen, Erkern, Türmchen, das als einer der schönsten Bahnhöfe Europas galt. Von hier fuhren Soldaten, Beamte, Schauspielerinnen und Hofratswitwen nach Krakau, Przemysl oder Lemberg. In der Gegenrichtung strömten aus den verarmten Dörfern Galiziens Handwerker und Dienstmädchen nach Wien.
Ankunft aus dem galizischen Schtetl
Wer keinen Beruf erlernt hatte, fand Arbeit an den Kohlerutschen des Nordbahnhofs. Wo in den vergangenen Jahren ein neuer Stadtteil mit teuren Eigentumswohnungen entstand, wurden früher die Waggons mit Schlesischer Kohle entladen und in Säcke verpackt, die Tagelöhner dann zu den Haushalten schleppten.
Nach der Aufhebung aller Reiseeinschränkungen 1867 kamen am Nordbahnhof immer mehr Jüdinnen und Juden aus den galizischen Schtetln nach Wien. Viele flohen vor der Armut auf dem Land, andere vor den Pogromen im Zarenreich. Der erste Eindruck, den sie von der Residenzstadt Wien bekamen, war die prächtige Ankunftshalle des Nordbahnhofs. Er vermittelte ihnen Hoffnung auf eine neue, eine bessere Existenz. Viele ließen sich gleich in der Umgebung des Bahnhofs nieder – im Volkert- und Alliiertenviertel.
Deportationen in 33 Zügen
Allerdings spielte der Nordbahnhof auch bei der Deportation der Wiener Jüdinnen und Juden durch die Nazis eine Rolle. Von 1943 bis März 1945 wurden fast 2.000 Jüdinnen und Juden in 33 Zügen vom Nordbahnhof nach Auschwitz und Theresienstadt deportiert. Das hat die Historikerin Michaela Raggam-Blesch mit Kollegen in einem Projekt für die Akademie der Wissenschaften dokumentiert. In einem Blog im Standard nannte Raggam-Blesch den Nordbahnhof einen „fast vergessenen Schreckensort“. Bis heute gibt es auf dem Areal kein Mahnmal oder irgendeine andere Form der Erinnerung.
Gegen Kriegsende wurde der Nordbahnhof durch Bomben und Artillerie beschädigt, aber nicht gänzlich zerstört. Der Trakt an der Nordbahnstraße war noch recht gut erhalten. In den 1950er Jahren überlegten die ÖBB sogar den Wiederaufbau. Das wurde aber schnell verworfen und stattdessen ein neuer Bahnhof direkt auf dem Praterstern gebaut. 1965 wurden die letzten Türme des alten Nordbahnhofs gesprengt und an seinem Platz zehnstöckige Wohnhäuser errichtet.
Vier Steinfiguren wurden gerettet
Von der Atmosphäre des Ankommens und Abfahrens ist heute in der Nordbahnstraße nichts mehr zu spüren. Sie ist eine typische Durchzugsstraße mit vier Fahrspuren und zwei Parkspuren für die Autos. Die Straßenbahn hat zwar einen eigenen Gleiskörper, wird jedoch durch zahlreichen Ampeln gebremst. In den vergangenen Jahren kamen noch Fahrradwege auf beiden Seiten hinzu. Niemand hält sich hier gerne länger auf.
Vom Gebäude des alten Nordbahnhofs wurden nur vier Steinfiguren gerettet, welche allegorisch für die Städte Wien, Brünn, Krakau und Olmütz standen. Sie sollen demnächst einen Platz im letzten Gebäude finden, das an die historische Bedeutung des Bahnhofs erinnert: Im alten Wasserturm im Nordbahnviertel.
Bernhard Odehnal lernte Journalismus bei der Stadtzeitung „Falter“ und war danach als Korrespondent und Reporter für österreichische und Schweizer Medien tätig. 2025 kehrt er mit der Gründung von „Zwischenbrücken“ in den Lokaljournalismus zurück. Er lebt in der Leopoldstadt.