Hilfe für die Helfenden
Wenn ein Mensch psychisch erkrankt, verändert sich das Leben aller in seinem Umfeld. In der Brigittenau bietet der Verein HPE Unterstützung für Angehörige.
Text: Nadja Riahi, Fotos: Christopher Mavrič

Im 5. Stock an der Brigittenauer Lände 50-54, mit weitem Blick über den Donaukanal befinden sich die Räumlichkeiten des Vereins HPE, kurz für „Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter“. Im Eingangsbereich steht ein großer metallener Ständer mit Infomaterialien. Entlang des Flures reihen sich mehrere Räume aneinander.
Manche Räume sind größer und bieten Platz für Gruppenrunden oder Workshops, andere kleiner und zurückgezogener – geeignet für vertrauliche Einzelgespräche. Sonnenlicht fällt durch große Fenster auf den dunklen Teppichboden, während von draußen das Rascheln der Blätter im sommerlichen Wind hereinweht.
Für die Angehörigen psychisch Erkrankter beginnt hier ein neuer Abschnitt in ihrem Leben. Zum ersten Mal können sie hier über ihre Sorgen und Belastungen, über Erfahrungen und Herausforderungen sprechen – und werden gehört.
Leben im Ausnahmezustand
Wie gravierend die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung im engsten Umfeld sein können, hat auch Thomas erfahren. Die schwere Depression seiner Mutter hat das Leben des Mitte 30-jährigen und jenes seiner Familie verändert. Er spricht von einem markanten Einschnitt: „Das Davor spielt kaum noch eine Rolle, weil die Dinge, um die sich mein Alltag dreht, um ihre Depression herum entstanden sind.“ Am meisten fehle ihm seitdem eine gewisse Leichtigkeit, sagt Thomas: Denn die ständige Sorge um seine Mutter schwinge jeden Tag mit.
Fünf Jahre ist es her, seit Thomas‘ Mutter sich als Folge ihrer Depressionen aufgrund von akuter Suizidgefahr selber ins Krankenhaus eingewiesen hat. „Mein Bruder und ich haben danach zweitweise abwechselnd bei ihr gewohnt, weil sie nicht in der Lage war, alleine für sich zu sorgen“, erzählt er.
So wie viele Angehörige durchlebt er einen ständigen Spagat zwischen Hilfsbereitschaft und Selbstschutz: „Man muss sich ein Stück weit von der eigenen Mutter distanzieren – so weit, dass man nicht selbst daran zerbricht und zugrunde geht, aber doch irgendwie da sein und unterstützen können“.
Jetzt zum Newsletter anmelden

Diese Erfahrung machen viele, die einen psychisch erkrankten Menschen begleiten oder sich um ihn sorgen. Das beobachtet auch Miriam Schögler, Beraterin bei der HPE. Sie erzählt, dass Angehörige oftmals versuchen, die Situation aus eigener Kraft zu meistern –so lange, bis sie an ihre Grenzen stoßen. Erst wenn der Druck zu groß wird oder sie nicht mehr weiterwissen, wenden sich viele an eine Beratungsstelle, wie die HPE.
Die Anliegen, mit denen Mitbetroffene zur Beratung kommen, reichen vom Wunsch nach mehr Information über konkrete Kommunikationsstrategien bis hin zum Bedürfnis nach emotionaler Entlastung. „Für viele ist das Gespräch ein wichtiger Schritt, um wieder Halt zu finden und neue Wege im Umgang mit der schwierigen Situation zu entdecken“, sagt Schögler. Besonders belastend werde es für Angehörige oft dann, wenn die erkrankte Person keine professionelle Hilfe annehmen möchte – in solchen Momenten fühlen sie sich häufig ohnmächtig oder hilflos.
Warum Angehörige oft übersehen werden
Die Betroffenen im nahen Umfeld lernen mit der Zeit, besser auf sich selbst zu achten. Thomas spricht etwa von einem wachsenden Bewusstsein für die eigenen Ressourcen und Grenzen. Auch Schögler betont, wie wichtig es ist, sich selbst nicht zu überfordern und bewusst auch mal „Nein“ sagen zu dürfen.
Die HPE rückt die Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen bewusst ins Zentrum, weil ihre Erfahrungen und Herausforderungen oft im Hintergrund bleiben. Während sie für ihre erkrankten Familienmitglieder eine unverzichtbare Stütze sind, finden ihre eigenen Sorgen und Erschöpfung nur selten Beachtung – sowohl im sozialen Umfeld als auch im Gesundheitssystem. Schögler sieht einen wesentlichen Grund dafür im gesellschaftlichen Umgang mit psychischer Gesundheit: „Auch 2025 ist es nach wie vor ein Tabuthema, in dem viel Scham und Schuldfragen stecken.“
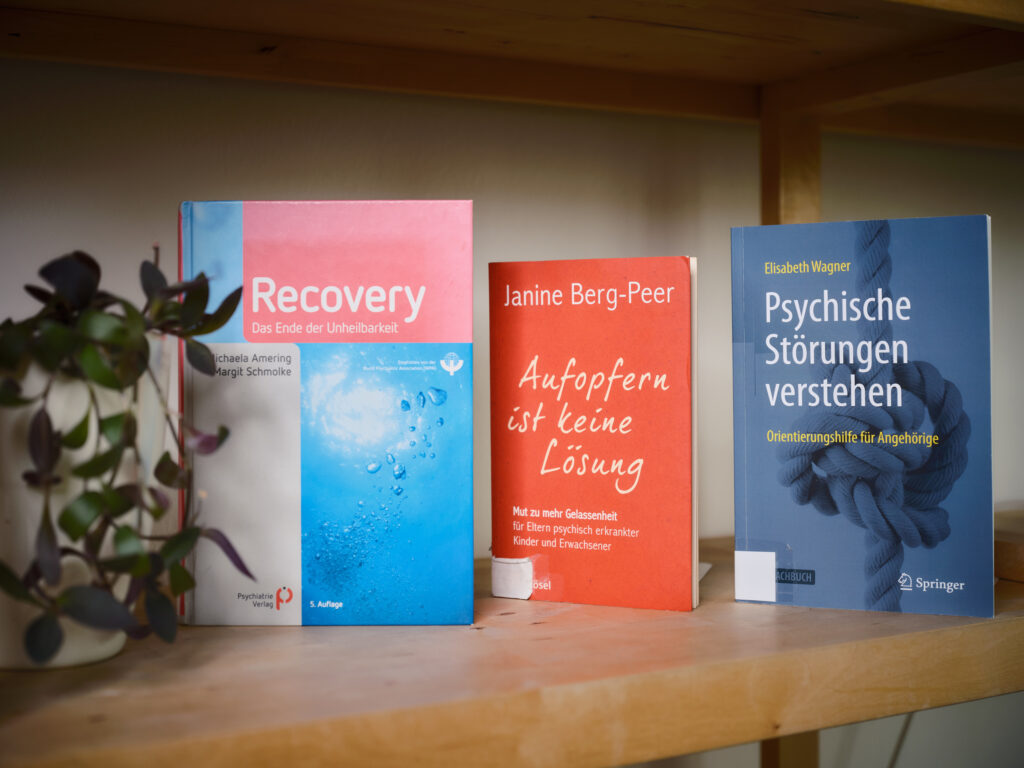
Ein wichtiger Bestandteil des Unterstützungsangebots der HPE sind die Selbsthilfegruppen, die von Angehörigen selbst geleitet werden. Thomas, der zunächst als Teilnehmer dabei war und heute eine Gruppe leitet, beschreibt den Ablauf so: „Im Normalfall starten wir mit einer Befindlichkeitsrunde, in der jeder erzählen kann, wie es ihm gerade geht. Dann schauen wir, ob jemand ein konkretes Anliegen oder ein akutes Thema hat – das wird dann gemeinsam in der Gruppe besprochen.“ Die Atmosphäre in den Treffen ist dabei sehr unterschiedlich: „Manchmal sind die Abende witzig, manchmal eher bedrückend. Es ist alles dabei.“
Gerade dieser offene Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gibt Halt und stärkt das Gefühl, nicht alleine zu sein: „Mit Menschen zusammenzusitzen, die denselben zynischen Humor teilen – und dann gemeinsam auch mal über das eigene Leid lachen zu können, das möchte ich nicht mehr missen.“ Die regelmäßigen Treffen bieten Thomas eine feste Anlaufstelle; das Wissen, ein Problem nicht monatelang mit sich herumtragen zu müssen, sei eine Entlastung, erklärt er.
Unterschiedliche Herausforderungen
Viele Menschen, die zur HPE kommen, hoffen auf schnelle und klare Lösungen für ihre schwierige Situation. Das Bedürfnis nach einem einfachen „Rezept“ zur Bewältigung der Probleme ist groß – verständlich angesichts der Belastung, unter der sie stehen. In der Beratung wird jedoch schnell deutlich, dass es solche Patentrezepte nicht gibt. Für die unterschiedlichen Herausforderungen existieren keine universellen Antworten, was für viele zunächst enttäuschend oder frustrierend sein kann. Gleichzeitig kann es aber auch entlastend sein zu erfahren, dass nicht alles sofort gelöst werden muss und dass Unsicherheiten dazugehören.
Eines der Ziele der HPE sei es auch, das Stigma abzubauen und sichtbar zu machen, was Angehörige und psychisch erkrankte Menschen trotz aller Schwierigkeiten leisten und bewältigen, so Schögler. Gerade weil Angehörige leicht aus dem Blickfeld geraten, ist es wichtig, dass sie sich nicht scheuen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Oft sind es Unsicherheiten, Scham oder die Sorge, anderen zur Last zu fallen, die Betroffene davon abhalten, sich Hilfe zu suchen. Doch diese Hemmungen abzulegen, ist ein entscheidender Schritt. „Was immer einen davon abhält, sich Hilfe zu suchen, sollte man einfach über Bord werfen – wenn man das Gefühl hat, dass man Unterstützung braucht oder sie gerne hätte“, lautet Thomas‘ abschließender Ratschlag.
Weitere Informationen:
https://www.hpe.at/de

Nadja Riahi
Nadja Riahi ist freie Journalistin, Moderatorin und Sprecherin in Wien. Sie beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen der Gegenwart und Zukunft, sozialen Ungerechtigkeiten, Gesundheit, Bildung und der Arbeitswelt.







